
Die Präsenz von unerwünschten Drohnen in der Nähe von sensiblen Orten wie Flughäfen, kritischen Infrastrukturen oder bei Großveranstaltungen stellt eine zunehmende Herausforderung für die Sicherheit dar. Die schnelle Verbreitung und technische Weiterentwicklung der Drohnentechnologie eröffnet zwar zahlreiche zivile und wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten, führt jedoch auch zu neuen Sicherheitsrisiken. Unerwünschte Drohnen können nicht nur zur Überwachung, sondern sogar als Werkzeuge für Angriffe dienen. Vor diesem Hintergrund hat das Deutsche Zentrum für Luft– und Raumfahrt (DLR) intensive Forschungen begonnen, um Technologien zur Drohnenerkennung und Drohnenabwehr zu entwickeln und zu optimieren. Das Ziel ist es, effektive Maßnahmen zu erarbeiten, die unerwünschte Drohnen frühzeitig erkennen, zuverlässig neutralisieren und somit potenzielle Gefahren für Menschen und Infrastruktur minimieren.
Fortschritte in der Erkennung und Verfolgung unerwünschter Drohnen
Der erste Schritt in der wirksamen Drohnenabwehr ist die schnelle und präzise Erkennung der Fluggeräte. Moderne Systeme nutzen hierfür ein Multisensorenkonzept, das Radar-, akustische, optische und Funkfrequenzsensoren kombiniert. Diese Sensoren ermöglichen es, einzelne Drohnen sowie Schwärme von Drohnen zu detektieren, zu klassifizieren und deren Positionen in Echtzeit zu verfolgen. Die von den Sensoren erfassten Daten gelangen in ein Lagezentrum, wo sie zusammengeführt und ausgewertet werden, um eine klare Lageübersicht zu generieren. Dort wird nicht nur die Identifikation einer Drohne vorgenommen, sondern auch deren Navigationsroute sowie eventuelle Absichten analysiert. Insbesondere in Bereichen mit kritischen Infrastrukturen sind zuverlässige Lagebilder von großer Bedeutung, um den Schutz und die Sicherheit zu gewährleisten. Die technische Herausforderung besteht darin, Drohnen auch in komplexen urbanen Umgebungen oder bei Störungen durch andere elektronische Geräte sicher zu erkennen und zu verfolgen.
Die Bedeutung der präzisen Detektion wird auch durch die steigende Anzahl von Drohneneinsätzen in verschiedenen Bereichen unterstrichen. Unbemannte Luftfahrzeuge kommen bei der Lieferung von Waren, bei Katastropheneinsätzen oder bei der Inspektion von Infrastrukturen zum Einsatz, sodass zwischen erlaubten und unerwünschten Flügen differenziert werden muss. Das DLR arbeitet daher an innovativen Sensoren und Algorithmen, die diese Unterscheidung in Echtzeit ermöglichen und dabei eine möglichst geringe Fehlerquote aufweisen. Die Einbindung von Künstlicher Intelligenz unterstützt die Auswertung der großen Datenmengen und verbessert somit die Genauigkeit der Drohnenerkennung.
Technologische Lösungsansätze zur Drohnenabwehr
Neben der Erkennung steht die effektive Unscharfmachung oder Neutralisierung der unerwünschten Drohnen im Fokus der Forschung und Entwicklung. Das DLR setzt dabei auf verschiedene Maßnahmen, die je nach Situation und Sicherheitslage angepasst werden können. Besonders hervorzuheben sind dabei Abfangdrohnen, die autonom agieren und gezielt feindliche oder störende Fluggeräte ausfindig machen, verfolgen und unschädlich machen.
Die Abfangdrohnen des DLR sind mit moderner Sensorik ausgestattet, die ihnen erlaubt, Drohnen in ihrer Umgebung zu identifizieren und präzise Flugmanöver durchzuführen. In erprobten Szenarien zeigte sich, dass eine solche Abfangdrohne in der Lage ist, eine fremde Drohne in der Luft einzufangen oder durch gezielte Kollisionen zum Absturz zu bringen. Dieses Verfahren zählt zu den besonders effektiven Methoden, da unerwünschte Drohnen so unmittelbar und physisch außer Gefecht gesetzt werden, ohne Schäden an der Umgebung zu verursachen.
Ein weiterer bedeutender Ansatz ist die Nutzung von Störsignalen, etwa durch gezielte Jamming-Technologien, die das Navigations- oder Kommunikationssignal der Drohnen beeinflussen. So können beispielsweise das GPS-Signal gestört oder die Funkverbindung zur Fernsteuerung unterbrochen werden, was die Drohne dazu bringt, automatisch zu landen oder den Flug zu beenden. Besonders in dicht besiedelten oder hochsensiblen Gebieten ermöglicht diese Technik eine kontaktlose und risikominimierte Neutralisation.
Das Projekt CUSTODIAN bündelt verschiedene Forschungsindizes des DLR zur Entwicklung ganzheitlicher Systeme für Detection, Interception und Neutralization von Drohnen. Im Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt kamen diese Technologien bereits erfolgreich zum Einsatz und bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Drohnenabwehr stetig zu verbessern.
Herausforderungen und Perspektiven in der Drohnenabwehr
Trotz des großen Fortschritts bei der Detektion und Neutralisierung bleiben zahlreiche Herausforderungen bestehen. Die Vielfalt der Drohnentypen mit unterschiedlichen Flugprofilen, Größenskalen und Ausstattungen erschwert eine universell einsetzbare Lösung. Zudem verlangen Einsatzgebiete wie Flughäfen hohe Sicherheitsstandards, bei denen selbst kleinste Fehlfunktionen katastrophale Auswirkungen haben können. Daher erfordert der Betrieb von Abfangdrohnen und Störsystemen eine präzise Abstimmung und Einbindung in bestehende Sicherheitskonzepte.
Ein weiteres Problem stellt die rechtliche Situation dar, da das Abfangen und Stören von Drohnen weitreichende Konsequenzen für den Luftverkehr sowie das Datenschutzrecht haben kann. Hier stehen Behörden, Betreiber und Forscher in engem Dialog, um geeignete Regelwerke zu schaffen, die den Schutz der Bevölkerung und kritischer Anlagen gewährleisten und gleichzeitig innovative Technologien zulassen.
Die Forschung am DLR setzt zudem einen besonderen Schwerpunkt auf die Resilienz von Drohnen gegenüber Störungen, denn auch legale unbemannte Luftfahrzeuge müssen in ihrer Funktionsfähigkeit geschützt werden. Das Drohnenkompetenzzentrum am Flughafen Cochstedt bietet optimale Bedingungen, um den Einsatz verschiedenster Drohnen unter realistischen Bedingungen zu erproben und zielgerichtete Abwehrmaßnahmen weiterzuentwickeln.
Langfristig wird erwartet, dass Drohnenabwehrsysteme zunehmend automatisiert und vernetzt arbeiten. So sollen Drohnen nicht nur einzeln, sondern auch Schwärme sicher erkannt und neutralisiert werden können. Die Integration von fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz und Big-Data-Analysen wird dabei entscheidend zum Erfolg beitragen. Zudem werden Synergien genutzt, indem zivile und militärische Abwehrstrategien kombiniert werden, um eine breite Palette an Bedrohungen abdecken zu können.
Fazit
Die Neutralisierung unerwünschter Drohnen ist ein komplexes und dynamisches Thema, das angesichts der steigenden Bedeutung unbemannter Luftfahrzeuge immer relevanter wird. Die Maßnahmen orientieren sich an einer mehrstufigen Herangehensweise, beginnend bei der umfassenden Detektion und Situationserfassung bis hin zur gezielten und sicheren Neutralisierung. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt leistet hierbei einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung innovativer Technologien, die an Flughäfen, in der Nähe kritischer Infrastrukturen oder bei Großveranstaltungen eingesetzt werden können. Abfangdrohnen, Abwehrsysteme mit Störsignalen sowie ein leistungsfähiges Sensor- und Lagebildsystem bilden zusammen ein effektives Schutzkonzept.
Durch intensive Forschung, praxisnahe Erprobungen und den ständigen Dialog mit Behörden und öffentlichen sowie privaten Stakeholdern wird die Drohnenabwehr stetig verbessert. Das Ergebnis sind flexible und skalierbare Lösungen, die den vielfältigen Anforderungen moderner Sicherheitsarchitekturen gerecht werden. So sorgt das DLR nicht nur für die Sicherheit des Luftraums, sondern trägt auch dazu bei, das Vertrauen in Technologien unbemannter Luftfahrt nachhaltig zu stärken.










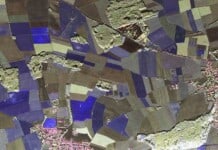
 Wingcopter und TAF Industries: Aufklärungsdrohnen für die Ukraine
Wingcopter und TAF Industries: Aufklärungsdrohnen für die Ukraine Wingcopter Langstreckendrohnen für Luftvermessung in Japan im Einsatz
Wingcopter Langstreckendrohnen für Luftvermessung in Japan im Einsatz Flybots-Initiative von DLR und TU Braunschweig: Prototypen im sicheren Käfig
Flybots-Initiative von DLR und TU Braunschweig: Prototypen im sicheren Käfig Drohnen zur medizinischen Versorgung in Mexiko im Einsatz
Drohnen zur medizinischen Versorgung in Mexiko im Einsatz Drohnen an deutschen Flughäfen: DLR-Auswertung von Drohnenereignissen
Drohnen an deutschen Flughäfen: DLR-Auswertung von Drohnenereignissen Automatisierte 5G-Drohneneinsätze im Katastrophen- und Rettungseinsatz
Automatisierte 5G-Drohneneinsätze im Katastrophen- und Rettungseinsatz














